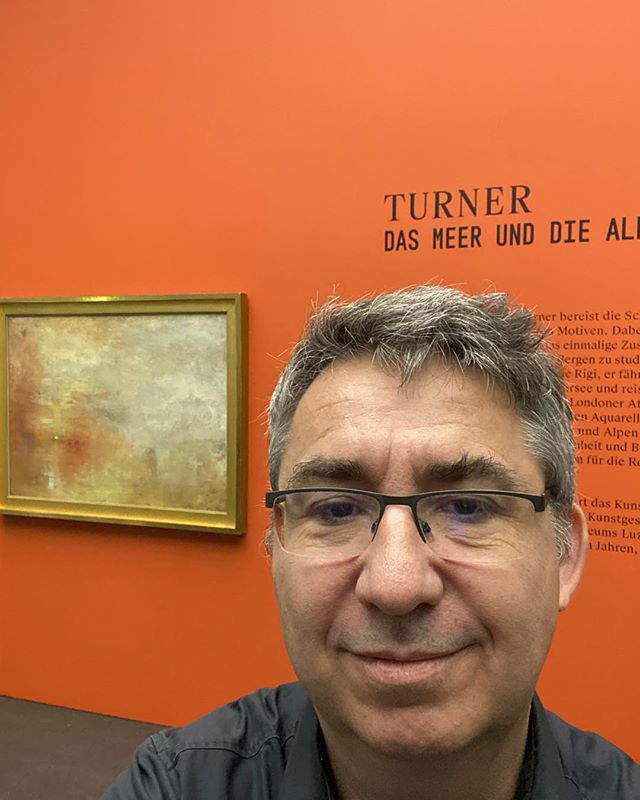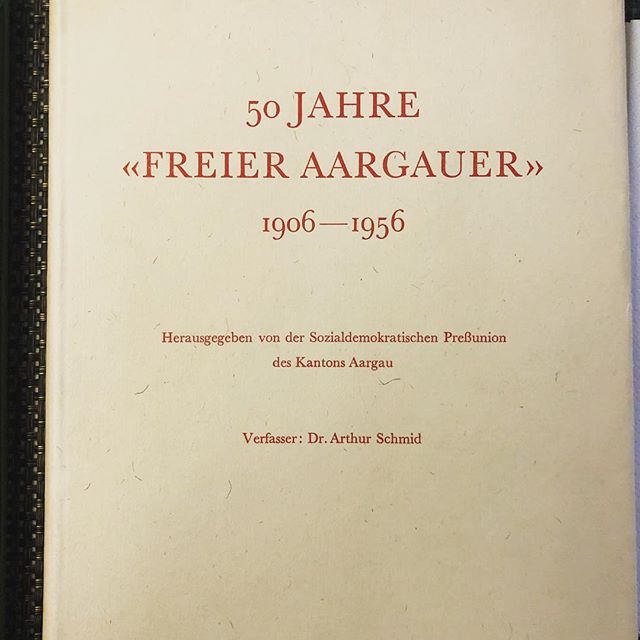Überwachungsstaat: «Das kann ja nicht die Lösung sein»
/ Der Autor Ilija Trojanow hat 2009 zusammen mit Juli Zeh das Buch «Angriff auf die Freiheit: Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte» veröffentlicht. Gestern hat Simone Fatzer ein kurzes Gespräch mit ihm im Echo der Zeit geführt.
Der Autor Ilija Trojanow hat 2009 zusammen mit Juli Zeh das Buch «Angriff auf die Freiheit: Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte» veröffentlicht. Gestern hat Simone Fatzer ein kurzes Gespräch mit ihm im Echo der Zeit geführt.
Auf die Frage, ob er denn nun, in Anbetracht der durch Edward Snowden bekannt gewordenen Überwachungsaktivitäten der westlichen Demokratien, auf gewisse Kommunikationsmittel bewusst verzichte, antwortete er:
Nein, das kann ja nicht die Lösung sein. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass aufgrund einer perversen staatlichen Dauerüberwachung, ich als Bürger gezwungen werde, irgendein Instrument, irgendeine Kommunikationsform, die mein Leben erleichtert, nicht zu nutzen. Genauso, wie ich es problematisch finde, dass manche Menschen sagen: "Gut, nun werde ich absolut alles verschlüsseln und geheimhalten". Dieser Zwang, dass man selber dann beginnt, solche Paranoiden verhaltensweisen nachzuahmen, ist an sich für mich schon nicht akzeptabel.
Immer wieder wird ja vorgeschlagen, dass wir einfach unsere E-Mails verschlüsseln sollen. Oder auch, dass wer Cloud-Dienste nutze, schlicht selber schuld sei. Das ist eine erstaunliche Haltung. Nur weil es technisch möglich ist, unsere E-Mails und andere Daten zu lesen, ist es noch lange nicht richtig, dass wir das zulassen. Wir hätten früher auch nicht akzeptiert, wenn ähnliches mit der Briefpost geschehen wäre. Wir dürfen nun nicht klein beigeben und uns zurückziehen, sondern müssen von der Politik verlangen, dass sie im Sinne der Bürgerrechte handelt und nicht gegen sie.
Ein Problem der Geheimdienste ist gemäss Trojanow:
...dass gerade im geheimen wirkende Bürokratien, jede technische Möglichkeit und jede rechtliche Grauzone, die sich ihnen bieten, auch ausnutzen. Das heisst, Selbstkontrolle gibt es bei Geheimdiensten nicht. Die einzige mögliche Kontrolle ist die einer demokratischen Transparenz.
Ich würde weiter gehen und sagen, dass überhaupt keine Kontrolle möglich ist. Darum sollten wir in der Schweiz auf jeden Fall darauf verzichten unseren Geheimdienst mit weiteren Werkzeugen auszustatten. Das Beste was man tun kann, ist, auf solche Organisationen im Staat zu verzichten, oder ihnen wenigstens nur die allernötigsten Rechte zuzugestehen.
Und noch einmal zur Wiederholung für alle, die denken, dass das alles nicht weiter schlimm ist, weil sie ja nichts zu verbergen haben:
Die genaue Lektüre, nicht nur meiner Akte, sondern auch vieler anderen Akten zeigt, dass es eine Irrealität gibt, die entsteht. Aufgrund dessen, dass man alles beobachtet, ist natürlich auch ein Generalverdacht auf alles gelegt, und dieser Generalverdacht trägt in sich eine Ernergie, die bestätigt sein will. Das heisst, es ist geradezu unmöglich, davor unschuldig zu wirken. Auch scheinbar naives oder harmloses verhalten erscheint aufgrund dieser tendenziösen Beobachtung dann als verdächtig.
Das sollte uns in der Schweiz an den Fischenskandal erinnern und diese Erinnerung wäre doch schon Grund genug, ein Nachrichtendienstgestzt wie es geplant ist, gar nicht erst zu diskutieren. Und sollte es trotzdem im Parlament durchkommen, müssen wir uns schon jetzt bereit machen:
Ich glaube dass entscheidende ist, dass man früh und wirklich heftig jetzt Widerstand leistet. Diese wirklich verlogene Schutzbehauptung, es sei zu Sicherheit des Bürgers gedacht, die dürfen die Bürger auf gar keinen Fall akzeptieren.
Hier ist das ganze Gespräch aus dem Echo der Zeit von SRF4 News vom 8. August 2013:
(Bild: © kebox - Fotolia.com)