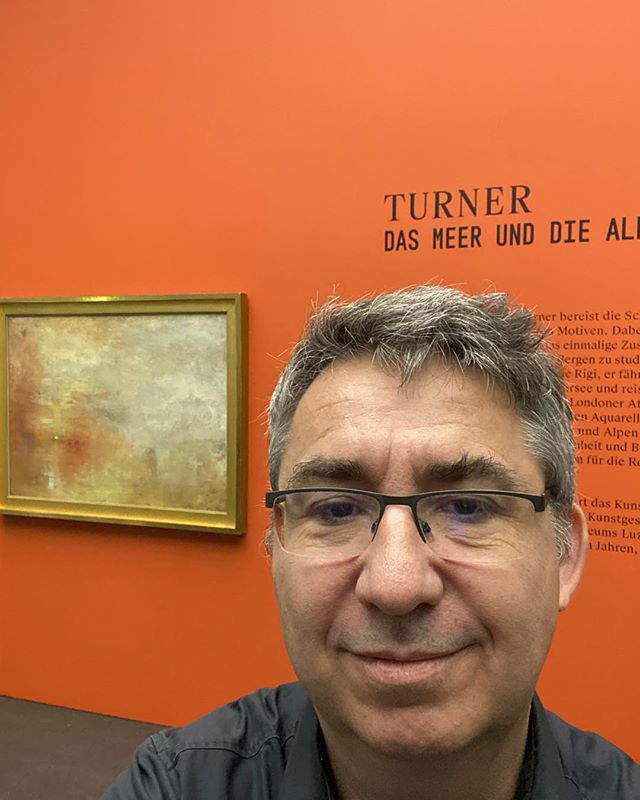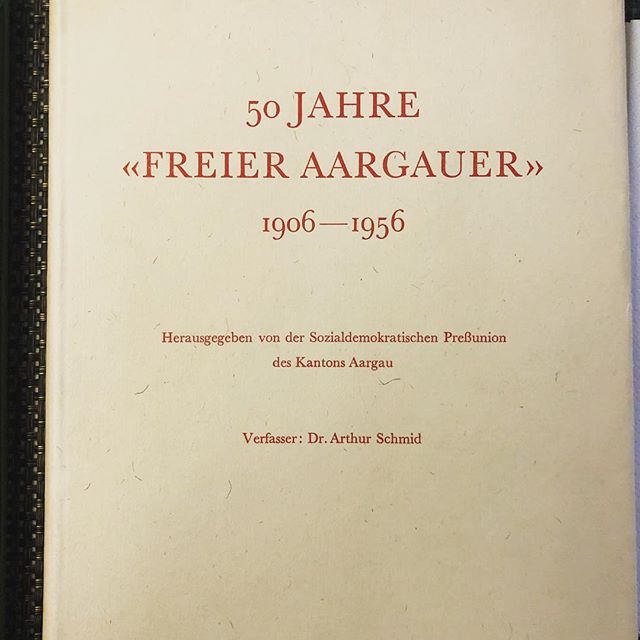Zum Fall Helene Hegemann ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Das Beste was mir bislang unter die Augen gekommen ist, von Regula Freuler in der letzten NZZ am Sonntag, "Literatur mischt alles mit allem", leider (noch) nicht online verfügbar.
Die allgemeine Hysterie, um die paar übertragenen Textstellen ist so lächerlich wie erhellend. Zeigt sie doch sehr schön, auf welchen Irrwegen wir uns im Bezug auf die Beurteilung der Produktion von kulturellen Artefakten bewegen. Dieselben Irrwege, die auch die Grundpfade für die gesellschaftliche Bewertung des Konstruktes des geistigen Eigentums bilden.
Wir glauben, dass es so etwas wie persönliche, eigene Ideen gibt, die dem gehören, der diese für sich behauptet.
Dieser Glaube ist vermutlich falsch. Jede Idee, jeder Gedanke steht auf einem anderen, bereits da gewesenen.
Ideen entstehen erst durch die Interaktion mit der Umwelt. Stellen wir uns im Gedankenspiel ein menschliches Gehirn vor, welches künstlich ernährt, ohne Sinnesorgane in einem dunklen Raum aufwächst und dort irgendwann, nach einem nicht gerade erfüllten leben, stirbt. Damit wir wissen, was in diesem Gehirn vor sich geht, stellen wir uns ein Display vor, dass die Ideen, die das Gehirn produziert anzeigt. Was würden wir wohl auf diesem Display sehen? Nichts, behaupte ich, ohne Kühnheit.
Das bedeutet nicht, dass jedes Individuum nicht auch seinen Beitrag zu einer ausgedrückten Idee leistet, sei dies ein Text, ein Bild, oder welche Art von kultureller Äusserung auch immer. Aber das Eigentum für diese Idee für sich beanspruchen zu wollen ist grundlegend falsch, um nicht zu sagen verwerflich.
Es ist falsch, weil die Idee nicht alleine aus sich selbst entstanden ist, und es ist falsch, weil sie gar nicht hätte entstehen können, wenn vorher alle anderen ein solches Dogma konsequent umgesetzt hätten. Wenn jeder das Eigentum auf seine Ideen geltend macht, und diese nicht verwendet werden dürfen, dann gibt es keine weiteren Ideen mehr.
Nun, einfach kopieren beinhaltet nicht die geringste Eigenleistung, könnte man hier einwerfen. Da Stimme ich sogar zu. Aber kopieren schadet auch niemandem. Und die Weitergabe und Weiterentwicklung von kulturellen Motiven, oder Meme oder wie immer sie nennen wollen basiert letztendlich darauf, dass sie kopiert werden müssen um weitergegeben werden zu können. Sie werden kopiert und dabei verändert, manchmal mehr, manchmal weniger. Originalität gibt es so, wie es uns das Wort vorgaukelt, eben nicht.
Jedes neue Werk beinhaltet Elemente von anderen Werken, manchmal sind es offensichtliche Zitate, manchmal eher versteckte, und oft einfach nicht mehr zurückverfolgbare Inspirationen.
Helene Hegemann hat ja auch keinen Roman kopiert oder abgeschrieben. Sie hat ein neues Werk geschaffen, punkt. Und dieses Werk wird wieder für andere Werke Inspiration sein, und irgendwann werden die "Vaselintitten" wieder verschwunden sein, oder vielleicht in hundert Jahren bei ein paar wenigen etymologischen Feinschmeckern die Diskussionsrunde bereichern.
Es gibt Kunstgattungen, bei welchen die gegenseitige Inspiration in Echtzeit stattfindet, zum Beispiel bei Improvisationen in Musik oder Theater. In anderen Bereichen ist der Prozess langatmiger, gehen die Meme verschlungenere Pfade, doch das Prinzip bleibt dasselbe.
Natürlich kann man sich wünschen, dass die Inspirationsquelle genannt wird, aber wichtig ist dies für die Gesellschaft nicht. Kommt dazu, dass diese Quelle in den meisten Fällen auch gar nicht bekannt ist.
Ich weiss zum Beispiel beim besten Willen nicht mehr, wo ich welchen Input für diesen Text erhalten habe. Wann, welcher Gedanke durch welchen anderen angestossen wurde. Es waren wohl Bücher, Webtexte, Gespräche, Zeitungsartikel? Es ist auch nicht wichtig.
Wichtig ist einzig, dass ein weiteres kulturelles Artefakt in der freien Wildbahn ist, und sich seinen Weg in die Gehirne der Menschen bahnen kann oder auch nicht, und dann irgendwann in den Tiefen des Datennetzes verstummt.
Wenn wir eine Gesellschaft wollen, die sich durch den kulturellen Austausch entwickelt, die geradezu durchtränkt ist von Ideen, welche sich auf verschiedenste Weisen manifestieren, sei dies in Texten, in Songs, in Bildern, in Filmen, usw. dann sollten wir diese Ideen, die wir durch das unsägliche Konstrukt des geistigen Eigentums domestiziert haben, wieder in die freie Wildbahn lassen.
In diesem Sinne hoffe ich, dass der Fall Hegemann dereinst als Ausdruck einer Zeit der Freilassung der Ideen gelten wird, und sich dieses Plagiatsgeschrei als letztes Aufbäumen eines vom austerbenden bedrohten Memes erweist.
Free the memes, and there may be a better world!
 Seit ein paar Wochen lese ich hin und wieder im Buch “Grundlagen der visuellen Kommunikation” (Affiliate Link) von Marion G. Müller, dass mir mal in einem Antiquariat in die Hände gefallen ist. Heute nach dem Sonntagsspaziergang setze ich mich also hin und lese ein, zwei Kapitel weiter bis ich, kurz bevor ich das Buch auch schon wieder weglegen wollte, auf folgende Stelle gestossen bin:
Seit ein paar Wochen lese ich hin und wieder im Buch “Grundlagen der visuellen Kommunikation” (Affiliate Link) von Marion G. Müller, dass mir mal in einem Antiquariat in die Hände gefallen ist. Heute nach dem Sonntagsspaziergang setze ich mich also hin und lese ein, zwei Kapitel weiter bis ich, kurz bevor ich das Buch auch schon wieder weglegen wollte, auf folgende Stelle gestossen bin: