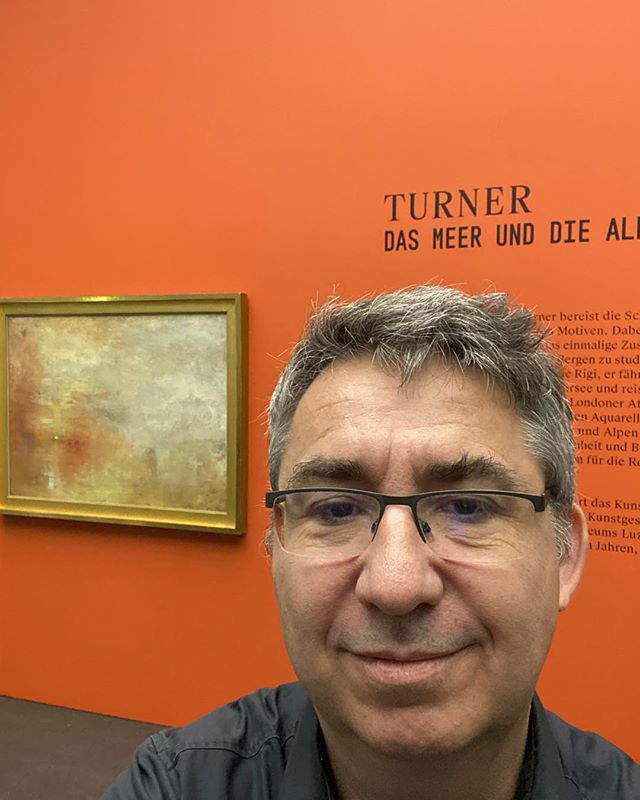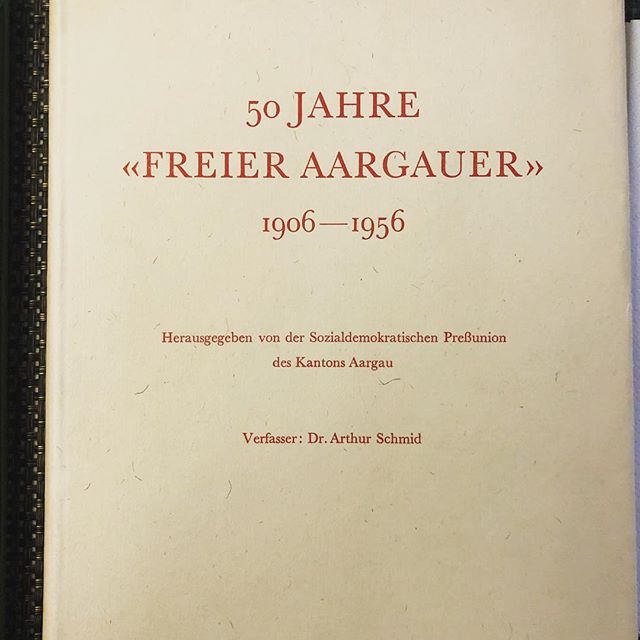Die Wissenschaft kann keine politischen Fragen beantworten
/ In der Zeit konnten wir kürzlich einen aufschlussreichen Beitrag mit dem Titel "Gekaufte Wissenschaft" lesen. Er zeigt anhand einiger Beispiele, wie die Wirtschaft Studien bestellt und ihren Einfluss auf Forschung und Lehre an den Hochschulen zunehmend professionalisiert (via @zurichlive).
In der Zeit konnten wir kürzlich einen aufschlussreichen Beitrag mit dem Titel "Gekaufte Wissenschaft" lesen. Er zeigt anhand einiger Beispiele, wie die Wirtschaft Studien bestellt und ihren Einfluss auf Forschung und Lehre an den Hochschulen zunehmend professionalisiert (via @zurichlive).
Es ist zwar durchaus zu kritisieren, dass vor allem die Transparenz in solchen Fällen oft zu wünschen übrig lässt, und darum auch wichtig, dass immer wieder auf solche Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht wird, aber die wirklichen Probleme in diesem Zusammenhang liegen eigentlich bei unserem Verständnis von Wissenschaft & Politik.
Erstens machen wir oft den Denkfehler, das Ettiket "wissenschaftlich" mit "wahr" zu verwechseln, und zweitens glauben wir, was noch viel gravierender ist, dass sich politische Fragen durch die Wissenschaft beantworten lassen.
Zum ersten Punkt: Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutet zwar, der Wahrheit verpflichtet zu sein. Doch liegt das Problem darin, dass wir als Menschen die "Wahrheit" nie vollkommen erkennen können. Unsere Körperlichkeit bietet uns ein beschränktes Set an Instrumenten. Diese Beschränkung verunmöglicht es uns, die "Wahrheit" über die Welt um und in uns jemals ganz zu erfassen. Wir können, um es mit Popper zu sagen, nur vermuten, und wir können uns darüber unterhalten, welche Vermutung wir als die derzeit beste Erklärung ansehen. Weiterhin können wir permanent anstreben, unsere Vermutungen noch besser der Wahrheit anzunähern.
Die Entscheidung aber, welche Erklärung wir derzeit als die beste betrachten, und damit sind wir bereits beim zweiten Punkt, kann uns niemand abnehmen.
Wenn der Autor schreibt, dass uns die Wissenschaft Antworten auf die Fragen, wie wir die Gesellschaft organisieren sollen, liefern kann, ist das ein Trugschluss. Die Wissenschaft kann uns höchstens helfen, diese Antworten zu finden, aber entscheiden müssen wir selbst. Darum sind wissenschaftliche Studien oder wissenschafltiche Aussagen von Fachexperten nie als Handlungsdirektiven zu interpretieren, sondern immer nur als Argumente, die der eigenen Entscheidungsfinung dienen können.
Es ist darum gar nicht nötig, dass die Wissenschaftler «unparteiisch» sind, wie das im Artikel gefordert sind. Eine Forderung die von niemandem eingehalten werden kann. Auch Wisschenschaftler haben einen Standpunkt und dieser sollte immer mitberücksichtigt werden. Kommt dazu, dass Wissenschaft nicht im "luftleeren" objektiven Raum stattfindet, sondern im Kontext des jeweiligen Zeitgeistes und der gerade gültigen wissenschaftlichen Paradigmen. Wissenschaftlichkeit einer Aussage oder einer Arbeit zeichnet sich m.E. dadurch aus, dass möglichst grosse Transparenz darüber herrscht unter welchen Bedingungen eine Arbeit entstanden ist und welche Daten und Fakten die Aussagen unterstützen.
Wie wir dann in einer politischen Frage entscheiden, kann nicht an die Wissenschaft delegiert werden. Wir müssen uns selbst fragen, was wir für richtig halten.
Wollen wir die Ehe für homosexuelle Paare zulassen? Wollen den Konsum von Canabis legalisieren? Wollen wir ein Nachrichtendienstgesetz in der Schweiz einführen? Wollen wir eine Zensurinfrastruktur um Hollywood Filme zu schützen? usw. Für solche Fragen kann die Wissenschaft uns zwar das eine oder andere Argument liefern, aber wie wir sie beantworten sollen, kann weder durch einen Algorithmus errechnet, noch aus den Daten gelesen werden.
Hier gilt es im Rahmen von möglichst deliberativen demokratischen Prozessen herauszuarbeiten, wie wir als Einzelne in der Gesellschaft zu diesen Fragen stehen und warum. Wir müssen herausfinden aufgrund welcher Argumente, Vorurteile und auch Gefühle wir so oder anders denken und wir müssen diese Erkenntnis artikulieren und mit unseren Mitmenschen austauschen um dann immer wieder von neuem vorläufige Entscheidungen zu treffen. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Wissenschaft.
(Bild: © creative soul - Fotolia.com)