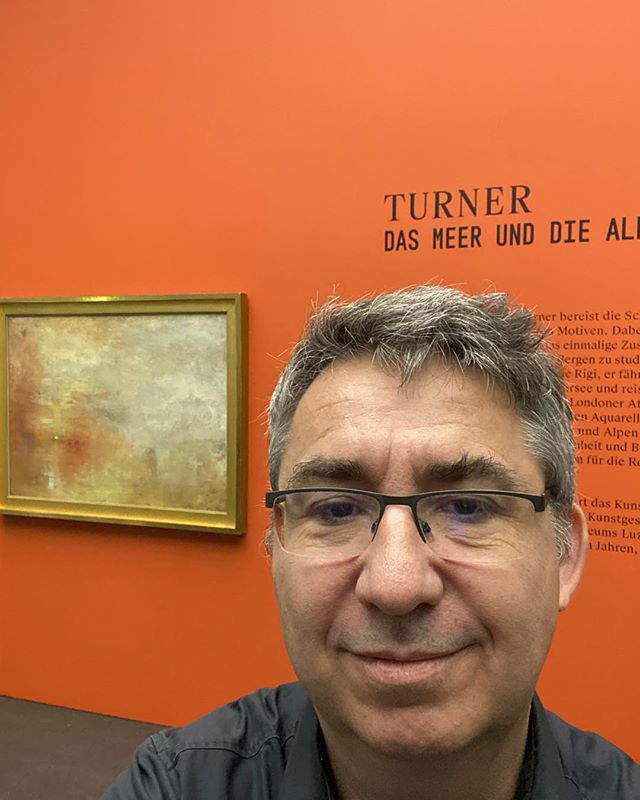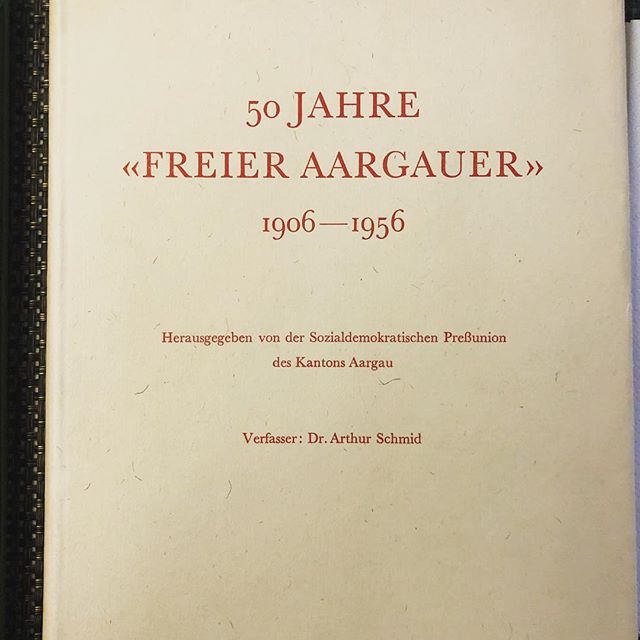Das Bananen-Experiment.
/ Ausschnitt aus dem Video: Das Bananen-Experiment von Severin Bruhin
Ausschnitt aus dem Video: Das Bananen-Experiment von Severin Bruhin
Wenn ich einen Tweet wie diesen lesen, werde ich natürlich sofort aufmerksam:
Das Bananen-Experiment: Wieso bezahlt man für eine Banane aber nur ungern für Musik-Downloads? bit.ly/VRnLYA
— Jrene Rolli (@gluexfee) February 6, 2013
Da hat also ein Student der ZHdK ein Video produziert, welches der Frage nachgeht, warum wir für Bananen freiwillig bezahlen würden, während dies für Musik nicht der Fall sei, wie wir in einem Beitrag bei NZZ Campus lesen können.
Der NZZ Campus Beitrag und das Video sollten nicht unkommentiert im Netz stehen bleiben.
- Es ist nicht wahr, dass für Musik im Internet nichts bezahlt wird. Gestern haben wir zum Beispiel lesen dürfen, dass via iTunes 25 Milliarden Songs verkauft wurden. Verkauft, nicht gratis heruntergeladen!
- Es ist erst recht nicht richtig, dass für Musik grundsätzlich nicht bezahlt wird. Die Menschen gehen an Konzerte, sie kaufen CD's, sie kaufen Songs und Alben online, sie geben Geld aus für Fan-Artikel.
- In der Schweiz gibt es keine illegalen Downloads. Der Download ist bei uns legal. Wobei ich damit nicht sagen will, dass er auch moralisch gerechtfertigt sei, doch dazu kommen wir später.
- Das Problem der allermeisten Musiker ist nicht, dass ihre Songs kostenlos heruntergeladen werden, sondern dass niemand deren Musik kopiert, weil sie bedeutunglos ist, oder zuwenig bekannt.
- Bananen und Musikaufnahmen sind nicht auf diese Weise miteinander vergleichbar. Wenn ich Deine Banane esse, ist sie weg und Du hast keine mehr, wenn ich Deinen Song herunterlade, ist er immer noch da.
- Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Metapher falsch ist. Im Netz ist es leider nicht so, dass ich zwischen der Möglichkeit des kostenlosen und des kostenpflichtigen Angebotes so einfach wählen kann, wie hier bei den beiden Bananenschalen. So einfach 50 Rp. auszugeben um einen Song zu bekommen, geht bei uns eben leider meistens noch nicht. In Zukunft wird das Möglich sein. Erste Services, die den Musiker ermöglichen den einfachen Kaufprozess mit einem Link einzuleiten sind bereits da oder im Anflug (z.B. Gumroad, Sellfy, BandCamp)
- Das teure Studio aus den 1980er Jahren, wie es am Anfang des Videos gezeigt wird, ist doch Geschichte. Einen Song zu produzieren ist um ein vielfaches günstiger und einfacher geworden. Darum gibt es ja unter anderem heute so viel mehr Musik zu konsumieren als vor 20 Jahren. Ich will ja nicht behaupten, dass es nichts kostet, Musik zu produzieren, aber ein Vermögen wie früher kostet es eben auch nicht mehr.
- Gleich nach dem Studio sehen wir eine Single abgebildet, während der Sprecher von Album spricht. Das ist zwar eine Nebensache, aber sagt uns vielleicht etwas über die Beliebigkeit des Projektes. Und auch hier sei angemerkt, dass gerade dadurch, dass man Musik heute online verkaufen kann, für junge und unbekannte Musiker viel mehr Chancen für die Verbreitung bestehen, als damals, als es nur den Weg über die Single oder das Album gab. Damals war man auf die Gnade der Vertriebsinsdustrie angewiesen, heute nicht mehr.
- Das Video suggeriert, dass jedes Album mit hohen Kosten produziert und dann im Internet kostenlos heruntergeladen würde, der Musiker ginge dabei leer aus. Nicht jedes Album wird kostenlos herunterladen und selbst wenn das so stattfindet, bedeutet das auch noch nicht, dass der Musiker dabei leer ausgeht. Es ist ganz einfach: Wenn er bekannt und beliebt ist, wird viel kostenlos heruntergeladen, aber auch viel gekauft. Wenn er unbekannt und unbeliebt ist, wird weder gekauft noch kostenlos herunter geladen. Um bekannt und beliebt zu werden, ist die Verbreitung von kostenloser Musik das effizientes Marketingmittel für das kleine Budget.
- Dann kommt die Frage: "Weshalb bezahlt man nicht?". Noch einmal: Diese Grundthese ist völlig falsch. Darum kann auch das Experiment keinen Erkenntnisgewinn bringen und das sieht man dann auch im Video.
- Von den 7 befragten Studenten haben fünf angegeben, dass sie zwar Musik auch gratis herunterladen, doch dass sie auch Musik kaufen. Nur 2 haben gesagt, dass sie nie bezahlen. Die Ausgangsfrage: "Warum bezahlen Studies freiwillig für Bananen, nicht aber für Musik" kann so als nicht gestellt werden.
- Am Schluss des Videos wird noch einer der Befragten mit dem Statement gezeigt, dass er kein schlechtes Gewissen habe, was sehr schön zeigt, dass das Video mit einer These im Kopf produziert wurde, und nicht mit einer offenen Frage. Und dass diese These unter allen Umständen bestätigt werden soll. Ein Experiment sieht anders aus.
Soviel zum Video, nur noch kurz ein paar weitere Bemerkungen.
Es ist sicher richtig, dass es viele Menschen gibt, die viel Musik auf Ihren digitalen Abspielgeräten haben, für die sie nicht bezahlt haben. Es ist aber absurd anzunehmen, dass für diese Musk bezahlt worden wäre, wenn es die Möglichkeit des kostenlosen downloads nicht gegeben hätte. In den meisten Fällen, würde einfach darauf verzichtet, den besagten Song im Player zu haben. Es gibt mehrere Gründe warum kostenlos heruntergeladen wird.
- Der Musikkonsument hat ein sehr kleines Einkommen zur freien Verfügung. Das ist meistens bei Jugendlichen und Studierenden der Fall. Aus demselben Grund hat man früher LP's von Freunden oder Radiosendungen getaped. Wenn das Geld knapp ist, setzt man Prioritäten. Das heisst aber nicht, und das sieht man auch im Video sehr schön, dass nie bezahlt würde. Es ist eher so, dass gezielt Musik gekauft wird. Weiterhin wird viel mehr von dem verfügbaren Geld in Clubs und an Konzerten ausgebeben als früher. Das ist eine indirekte Bezahlung von Musik.
- Die Musik ist einfacher kostenlos herunterzuladen als zu kaufen. Solange die Labels und Künstler ihre Songs nur via iTunes, Amazon und Google Play anbieten, statt einfache Mögichkeiten im Web bereitzustellen. Solange ein Song, wenn ich nach ihm oder der Band im Web suche nicht als erstes auftaucht und ich dort so einfach bezahlen kann, wie im Video für die Banane, solange wird auch kostenlos downloaded. Und statt zu versuchen, die kostenlosen Download-Angebote zum verschwinden zu bringen, was eh nicht gehen wird, ohne massiven Schaden an der Gesellschaft, sollten sich die Labels und die Künstler darauf konzentieren, wie sie im Web ihre Songs einfach an den Fan verkaufen können, ohne dass sie den grössten Teil der Einnahmen an irgendwelche Zwischenhändler abgeben müssen. Noch einmal z.B. mit Gumroad, Sellfy, BandCamp, usw.
- Die Songs sind zu teuer. Das kommt auch einmal im Video vor. CHF 1.60 für einen Song ist vielleicht einfach zuviel verlangt? Das ist ja auch ein völlig willkürlich festgelegter Preis. Vielleicht sollte der Preis eher bei CHF 0.50.-- liegen, oder nich tiefer? Ich weiss es nicht, der Musiker ist hier angehalten, auszuprobieren, was der Konsument für seine Musik zu bezahlen bereit ist. Sicher ist nicht für jeden Konsumten jeder Song gleich viel wert, warum auch?
- Und dann gibt es noch den Jäger und Sammler, der alles auf seinem Computer abspeichert, was er kriegen kann. Doch auch hier gilt, das es sich nicht um entgangegen Umsatz handelt. Dieser Mensch würde schlicht darauf verzichten, wenn er die Songs nicht mehr kriegen würde.
Dann die moralische Frage, die immer wieder in den Raum gestellt wird, ob es fair sei, für Musik nicht zu bezahlen. Ich werde diesen Aspekt in mehreren Blogposts behandeln müssen, denn es ist eine sehr komplexe Frage. Wer die Welt und den Prozess der Musikverbreitung als einfachen Interaktionsprozess zwischen Musiker und Musikkonsument sieht, kann schon auf die Idee kommen, dass es unfair sei, wenn jemand etwas kostenlos herunterlädt, aber die Welt ist nun mal nicht so simpel. Es sind viele Protagonisten, Aspekte und Wertvorstellungen zu berücksichtigen um die moralische Frage zu beantworten. Fairness ist ein sehr unscharfer Begriff. Wir könnten auch fragen, ob es fair sei, dass Stundenten, die kein Geld haben, für Musik bezahlen müssen? Oder ob es fair sei, dass Leute, die ein Speichermeidum kaufen, um dort ihre eigenen Dokumente abzuspeichern, für Musik bezahlen müssen, die sie nie anhören? usw. Aber wie gesagt, heben wir uns die moralischen Fragen in diesem Zusammenhang für später auf.
Das Problem der meisten Musikschaffenden ist nicht, dass ihre Songs entgegen ihrem Willen kostenlos heruntergeladen werden, sondern dass sie ihre potentiellen Fans gar nicht erst erreichen. Es gibt einfach sehr viel Konkurrenz um die wenigen verfügbaren Aufmerksamkeitsminuten der Musikhörer. Nur wer einigermassen erfolgreich ist, hat auch das Problem, dass seine Songs im Netz dort zu finden sind, wo er das nicht möchte. Dann aber, ist es kein Problem mehr. Oder anders gesagt, wer 100'000 Songs verkauft, kann sich über die 100'000 kostenlos Downloads, die es vielleicht auch noch gibt, freuen, denn das sind offenbar Fans, die seine Kunst weiterbringen. Wer nur 100 Downloads verkauft, der hat ein anderes Problem, aber bestimmt nicht, dass es dazu noch 100 kostenlos Downloads gibt. Und wer nichts verkauft, wird kaum unter kostenlosen Downloads leiden, denn offenbar interessiert sich niemand für seinen Songs.
Passend zu diesem Thema wäre vielleicht wieder einmal das Buch "Freie Kultur" von Lawrence Lessig zu lesen, welches man übrigens auf Wunsch von Autor und Verlag auch kostenlos downloaden kann.