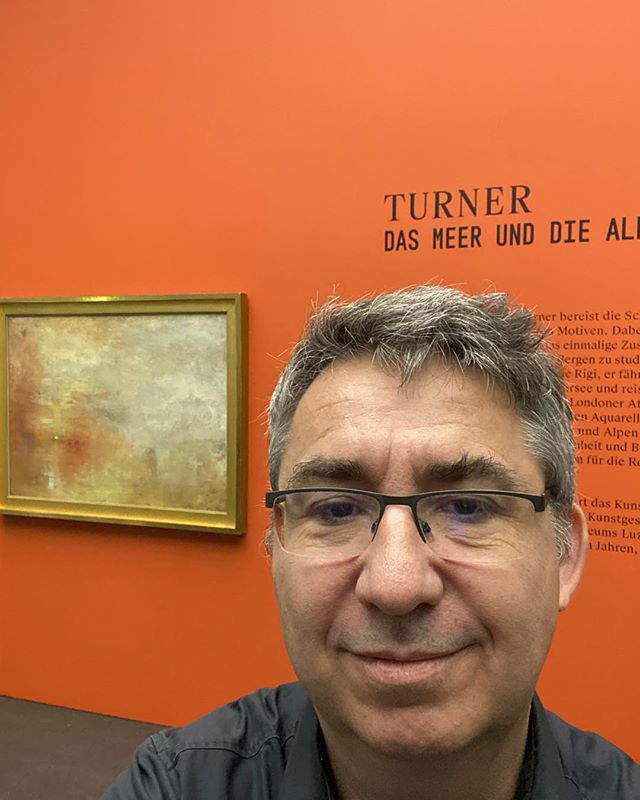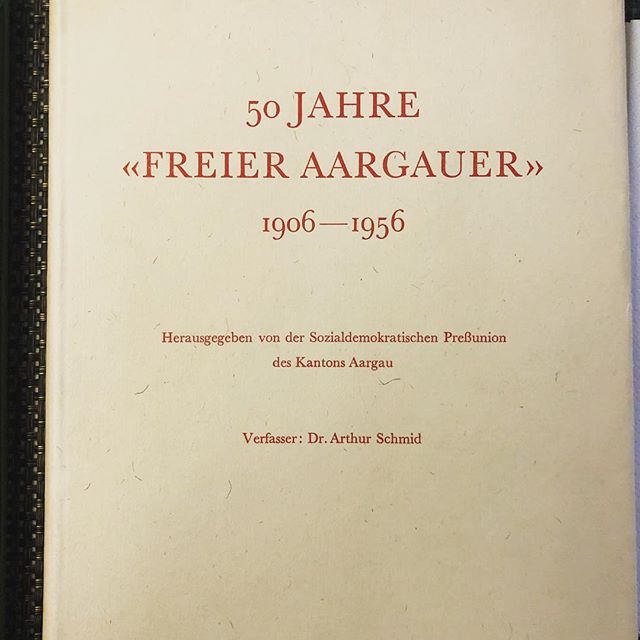Die Befürworter eines strengen Urheberrechtsregimes mit langer Schutzdauer, so wie es sich heute darstellt und weiter verschärft werden soll, bringen neben vielen anderen oft auch folgendes Argument in die Debatte: Nur eine lange Schutzdauer kann sicherstellen, dass Werke auch veröffentlicht bleiben.
Die Befürworter eines strengen Urheberrechtsregimes mit langer Schutzdauer, so wie es sich heute darstellt und weiter verschärft werden soll, bringen neben vielen anderen oft auch folgendes Argument in die Debatte: Nur eine lange Schutzdauer kann sicherstellen, dass Werke auch veröffentlicht bleiben.
Als jemand, der sich mit kulturellen Produktionen beschäftigt, stelle ich allerdings fast täglich fest, dass insbesondere Nichenproduktionen sehr schnell von der Bildfläche verschwinden und dann aufgrund des Urheberrechtsschutzes, der bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors anhält, nie mehr publiziert werden. So ist zum Beispiel mehr oder weniger das komplette Filmschaffen der Schweiz des 20. Jahrhunderts für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es gibt offenbar keine oder zuwenige ökonomische Interessen, die Spiel- und Dokumentarfilme, aber auch die Radio- und TV-Produktionen digital zu verwerten, bzw. es ist, aufgrund der Rechtesituation schlicht zu aufwändig. Dasselbe gilt leider auch für die meisten Bücher und Musikaufnahmen.
Ich spreche hier nicht von HD-Läppli Filmen oder von Krokus-Alben, sondern von den vielen kleinen, bei der Erstveröffentlichung vielleicht weniger erfolgreichen Werken, die längst vergessen sind, aber einen unschätzbaren Wert für das Verständnis der jeweiligen Zeit darstellen. Jedes Werk, egal wie intensiv die Rezeption bei der Erstveröffentlichung war, stellt eine erhaltenswürdige Quelle zur Zeitgeschichte dar. Die Früchte menschlicher Kulturarbeit sind das Einzige was übrigbleibt, und bilden damit die wichtigsten Tore zu unserer Vergangenheit.
Erstmals wird nun durch eine interessante Studie auch empirisch belegt, was ich und viele andere seit langem intuitiv wahrnehmen: Das heutige Urheberrecht bringt Werke vor allem schnell wieder zum Verschwinden und sorgt nicht dafür, dass diese möglichst lange verfügbar bleiben. (How Copyright Makes Books and Music Disappear (and How Secondary Liability Rules Help Resurrect Old Songs, Paul J. Heald, 2013)
Heald schreibt im Abstract:
Copyright correlates significantly with the disappearance of works rather than with their availability. Shortly after works are created and proprietized, they tend to disappear from public view only to reappear in significantly increased numbers when they fall into the public domain and lose their owners.
Er zeigt, dass heute mehr als doppelt soviele Bücher aus dem Jahre 1890 verfügbar sind, als Bücher aus dem Jahre 1950, obwohl 1950 viel mehr Buchtitel als 1890 publiziert wurden.
In der Studie wird auch auf die Situation in der Musikbranche eingegangen und er kommt auch dort zum selben Schluss:
In short, copyright seems to make both books and songs disappear.
Es ist nun natürlich so, dass dieser Effekt, insbesondere von der Content-Industrie, gewollt ist. Es herrscht die Meinung vor, dass es gut ist, wenn "das alte Zeugs" nicht verfügbar ist, denn auch jedes Stück Inhalt aus der Vergangenheit buhlt natürlich auch um das rare Gut Aufmerksamkeit.
Ich denke dagegen, dass es für die Autoren der Werke schleicht ist, wenn ihre Produktionen nicht verfügbar sind und es ist für die Gesellschaft schlecht, wenn sie sich nicht oder nur sehr eingeschränkt mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen kann.
Wir sollten darum die Schutzfristen des Urheberrechtes massiv verkürzen. Von heute 70 Jahre nach dem Tod des Autors, was völlig absurd ist, auf maximal 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Werkes.
(Bild: © olly - Fotolia.com)