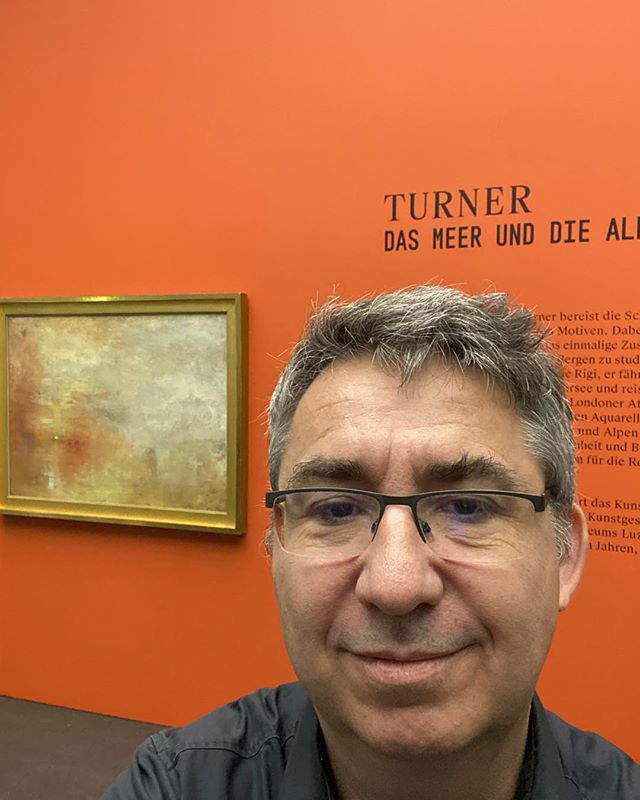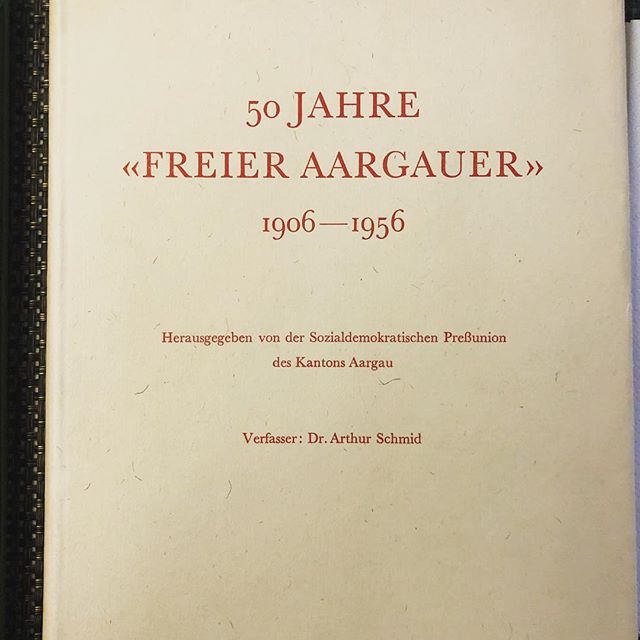Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich bin der Meinung, dass das Leistungschutzrecht für Presseverleger in der Schweiz mit allen Mitteln verhindert werden muss. Wir dürfen auf keinen Fall auf den von einigen Befürwortern eines solchen Maulkorb-Gesetztes neu eingeschlagenen konzilianten Ton hereinfallen. Es wäre völlig falsch hier auch nur die kleinste Kompromissbereitschaft zu signalisieren. Ein solches Gesetz kann nur schlecht sein für die Gesellschaft, denn es wird immer darauf hinauslaufen, dass grosse Konzerne mehr Macht erhalten und die Vielfalt der Kommunikationskanäle eingeschränkt wird. Auch wenn die Verleger in der Schweiz nun etwas "Kreide gegessen" haben, werden sie bei der konkreten Umsetzungsdiskussion eines solchen Gesetzes alles, was Grösse stärkt und ihnen Wettweberb vom Halse schafft, einbringen.
Bis vor kurzem gab es ja nur Äusserungen einzelner Exponenten der Schweizer Mediengrosskonzerne. Seit heute haben wir so etwas wie eine offizielle Stellungnahme des Verbandes Schweizer Medien. In der NZZ vom 15. Januar 2013 äussert sich deren Geschäftsführer Urs F. Meyer zum Thema und legt dar, warum ein solches Leistungschutzrecht gefordert wird. Der wichtigste Kampf um den Erhalt und den Ausbau der Medienvielfalt in der Schweiz seit Jahrzehnten ist damit offiziell eingeläutet.
Ich werde hier nur kurz auf die trügerischen Metaphern und Argumente, die im heutigen NZZ Beitrag von Urs F. Meyer verwendet werden eingehen.
Das Internet ist kein Wochenmarkt
Meyer beginnt mit einem beschaulichen Bild um uns einzulullen:
"Vergleichen wir das Internetangebot doch einmal mit einem traditionellen Wochenmarkt: Da kommen die regionalen Bauern, mieten einen Marktstand, bezahlen die Marktgebühr und bieten ihre Produkte an." (Urs F. Meyer, Geschäftsführer Verband Schweizer Medien, NZZ Online)
Doch das Internet bzw. was World Wide Web sind keineswegs mit einem Wochenmarkt vergleichbar. Ein Wochenmarkt liegt an einer Strasse oder an einem Platz. Alle Besucher des Wochenmarktes versammeln sich entlang dieser Strasse oder dieses Platzes. Das Netz ist völlig anders gebaut. Es gibt zwar die Maktstände, wenn wir dieses Bild schon bemühen wollen, aber es gibt keine feste Strasse und keinen festen Markt. Die Wege zu den Martkstandbetreibern sind dynamisch, werden jede Sekunde tausendfach neu gebaut. Es sind die Links, die die Strassen darstellen und die Klicks die Laufkundschaft; und diese Links werden fortwähren neu gesetzt und neu geklickt. Es gibt zwar solche Marktplatzstrukturen auch im Web. Das wären dann aber eher die Aktionsplattformen wie eBay und Ricardo. Der weitaus grösste Teil der Internet-Umsätze wird aber nicht an diesen Marktplätzen generiert, sondern direkt an den Marktständen. Die Aufgabe des Standbetreibers ist dauernd dafür zu sorgen, dass die Links zu ihm gebaut und geklickt werden, und nicht den Märkten entlang zu fahren.
Dann kommt die böse Google ins Spiel:
"Die Beschaulichkeit wird dann jedoch massiv gestört, wenn ein aussenstehender Anbieter ohne eigene Marktware einen riesigen Marktstand mietet, sich bei einzelnen Bauern, ohne zu fragen, geschweige denn gar zu bezahlen, Produkte von der Auslage nimmt und sie bei sich, nach eigener, nicht transparenter Rangordnung, mit dem Hinweis ausstellt, man könne sie beim jeweils genannten Bauern kaufen gehen. " (Urs F. Meyer, Geschäftsführer Verband Schweizer Medien, NZZ Online)
Ich hoffe, es ist bereits klar, warum dieses Bild völlig daneben ist. Es gibt wie gesagt, den Marktplatz im Netz so nicht. Die verwendete Metapher hier ist aber gleich doppelt falsch. Google und andere Aggregatoren nehmen den Presseverlegern nichts weg aus der Auslage. Das würde ja bedeuten, dass wir den Artikel dessen Anriss Google anzeigt, nicht mehr in der Originalquelle lesen könnten. Wenn ich einen Apfel aus der Auslage nehme und ihn bei mir einstelle, ist er beim Bauern weg und damit wertlos. Wenn ich einen Artikel-Anriss nehme, diesen im Netz woanders darstelle, und einen Link zur Quelle baue, dann ist der Artikel bei der Quelle noch vorhanden und durch den Link wertvoller geworden.
Warum wollen denn die Presseverleger sowas nicht, wenn ich behaupte, dass die Links der Aggregatoren ihnen etwas bringt? Die sind ja auch nicht blöd, oder?
Richtig. Sie sind überhaupt nicht blöd. Das Problem für die Verleger ist, dass sie viel stärkerer Konkurrenz ausgesetzt sind, weil es viel einfacher ist, eine "Strasse" aus Links zu bauen und wieder abzubauen. Sprich, weil die Linkwelt eben ausserordentlich dynamisch ist, und jeder Mensch mit einfachen Mitteln jederzeit die beste Quelle sein kann, und deswegen die Verleger zu recht um ihre Vormachtstellung bangen, wollen sie das Leistungsschutzrecht. Das Problem für die Presseverleger ist, dass die neue Medienwelt, die am entstehen ist, viel mehr Diversität bieten wird. Die Marken der Zukufnt sind Journalisten und kleine Journalistenkollektive, die ohne dass sie sich bei den Verlagen versklaven müssen, direkt an Ihr Publikum gelangen können und auch direkt monetarisieren werden können. Die grossen Medienkonzerne wissen genau, dass die von Ihnen als Internet-Idealisten und Träumer betittelten Menschen recht haben. Ihre Zeit nähert sich dem Ende und entgegen den Behauptungen ihrer Protagonisten und Lakaien, ist das gut so.
Das heisst nicht, dass die Zeit des Journalismus zu Ende wäre, im Gegenteil. Es heisst auch nicht, dass es keinen Platz für gute Verlage gäbe, im Gegenteil. Es wird wieder Vielfalt herrschen und es wird viele kleine Inhaltenabieter geben, die hervorragenden Journalismus bieten werden. Dieser Journalismus wird vielleicht etwas anders aussehen als heute, aber er wird wohl seiner Rolle des Watchdogs der Gesellschaft und des Raumes für die öffentliche Debatte gerechter werden, als der den wir heute haben - sofern wir das Leistungschutzrecht verhindern. In der Schweiz können wir das zum Glück und darauf müssen wir uns vorbereiten. Aber ich schweife ab...
Nochmal zu diesem unsäglichen Marktplatz / Bauern Bild: Google ist in dieser Situation sicher nicht derjenige, der einen eigenen, nur viel grösseren, Marktstand aufgestellt hat, um den armen lieben Bauern aka Meidenkonzerne wie Ringier, Tamedia, usw. die Apfel weg zu nehmen. Wenn schon ist Google die Firma, die viel dazu beiträgt, dass immer wieder neue Strassen mit Laufkundschaft gebaut werden und dass diese Strassen zu den Bauern führen. Und hier gleich noch angefügt: Wir könnten ja denken, dass Herr Meyer mit den Apfeln, die ihm weggenommen werden, die Journalistischen Inhalte meint. Das ist nur oberflächlich so, er sagt Apfel damit wir glauben es gehe ihm um Inhalte, aber er mein Rosinen, nähmlich die Inserate, die ihm weggenommen wurden.
Es ist eben nicht so, dass in dem Bild, welches Herr Meyer verwendet, die Presseverlage die Bauern auf dem Marktplatz darstellen. Die Bauern sind die Journalisten, die Äpfel sind die Inserate; die Verlage hatten früher einfach den Martkplatz für sich gepachtet und konnten für den Zutritt zu diesem dafür verlangen, was sie wollten. Das ist das Problem der Presseverleger: es braucht keine solchen Marktpläzte mehr.
Halten wir also fest, dass diese Metapher vom Marktplatz und den Bauern absolut trügerisch ist und überhaupt nichts mit dem Problem des Leistungschutzrechtes zu tun hat. Oder anders gesagt: Lassen wir uns nicht veräppeln.
Es geht weiter:
"Im obenstehenden Beispiel aber tritt der aussenstehende Anbieter machthaberisch auf, nimmt, ohne zu fragen, und diktiert, wem das nicht passe, der solle zusätzliche Arbeit leisten, indem er seine Angebote entsprechend markiere, damit sie von der Marktschau nicht berücksichtigt werden." (Urs F. Meyer, Geschäftsführer Verband Schweizer Medien, NZZ Online)
Diesmal will der Schreiber uns weismachen, dass es Arbeit bedeute, in einem einzigen File ein Attribut zu setzen. Ja, stimmt: 10 Min. Wenn es nur dieses Problem ist, welches die Presseverlage gelöst haben möchten, werden wir eine Spendestelle einrichten, um das Geld zu sammeln, welche für die Bezahlung der Arbeit, die dafür notwendig ist, zu bezahlen. Wir werden wohl nicht mehr als 10'000 CHF zusammenbringen müssen, um allen Presseverlagen in der Schweiz anzubieten, ihre robots.txt kostenlos so einzurichten, damit sie aus dem Google Index verschwinden.
Der Witz ist eben, dass die Verlage nicht möchten, dass sie aus dem Index verschwinden, denn es ist ja in der Tat wertvoll dort zu sein, sondern sie möchten, dass Google und Co. dazu gezwungen werden sie zu indizieren und dafür zu bezahlen. Das zeigt der Aufschrei, der durch den Blätterwald (ja, vor allem dort) ging, als Google angekündigt hat, in Frankreich die Presseverlage aus dem Index zu nehmen, wenn dort ein Leistungschutzrecht eingeführt würde. Manchmal wird auch das Beispiel Belgien genannt, wo Google das auch tatsächlich gemacht hat. Da hiess es allenorten, dass dies Erpressung sei. Kann es noch absurder gehen? Das würde ja bedeuten, dass der grosse böse Marktplatzhirsch, der den mächtigen Stand aufgestellt und die Äpfel geklaut hat, nun plötzlich die Äpfel nicht mehr zurückgeben darf, sondern jeden Tag neue kaufen muss, auch wenn er gar nicht will?
Wichtig sind auch die Äusserungen zum Kartellrecht, die immer wieder gemacht werden. Es heisst dann jeweils von Seite der Presseverlage, sie könnten nicht einfach ihre Inhalte aus dem Index löschen. Dies müssten alle gleichzeitig machen, was sie aber aus kartellrechtlichen Gründen nicht dürften. Ich kann das nicht beurteilen, aber diese Aussage steht dann natürlich im krassen Gegensatz zu der Behauptung von Herrn Meyer im Artikel:
"Will ein Verlag seine Produkte verkaufen, sollen sie entsprechend im Internet erscheinen. Will jemand seine Zeitungen gratis publizieren, so soll er das können, ..." (Urs F. Meyer, Geschäftsführer Verband Schweizer Medien, NZZ Online)
Wenn das so wäre, dann würde ja, sofort nach Einführung des Gesetzes jemand, oder mehrere Anbieter ihre Angebote ohne das Leistungsschutzrecht zu bemühen ins Netz stellen. Diese hätten dadurch einen enormen Trafficvorteil gegenüber allen anderen die dafür Geld verlangen wollen. Die Presserverleger müssen also ein Leistungschutzrecht einrichten, welches unliebsame Konkurenz, die darauf verzichten will, verhindert, denn sonst wäre es völlig nutzlos.
Wenn das aus Opportunitätsgründen nicht von Anfang an gefordert wird, müssen wir damit rechnen, dass bald nach der Einführung eines solchen Leistungsschutzrechtes, weitere Wünsche lautbar werden. Es wird dann gejammert werden, dass es da draussen im Netz von Google und Co. finanzierte (früher war es der Kommunist) Unternehmen gäbe, die das Leistungsschutzrecht nicht nutzen, sondern einfach so, ohne zu fragen journalistische Erzeugnisse ins Netz stellen, was ihr Geschäftsmodell tropiere und dass sie untergehen werden, wenn die Politik nicht eingreife. Das Ergebniss wäre dann wohl eine Bewilligungspflicht für journalistische Erzeugnisse, wie wir es absurderweise ja schon im RTVG kennen (Art. 3 RTVG) und deswegen wohl auch kein YouTube in der Schweiz haben.
Ach, ich könnte noch lange weiter machen, aber lasse es für heute mal gut sein. Das Thema wird uns wohl die nächste Zeit beschäftigen. Es gilt nun wachsam zu sein, und zu schauen, welche Vorschläge aus der AGUR12 hervorgehen. Es hat ja mit dieser Arbeitsgruppe eigentlich ganz harmlos begonnen. Aber ich hege grösste Befürchtungen, dass wir uns für einen heftigen Kampf gegen eine URG Revision rüsten müssen, die das Netz, wie wir es heute kennen, zur Geschichte machen will.