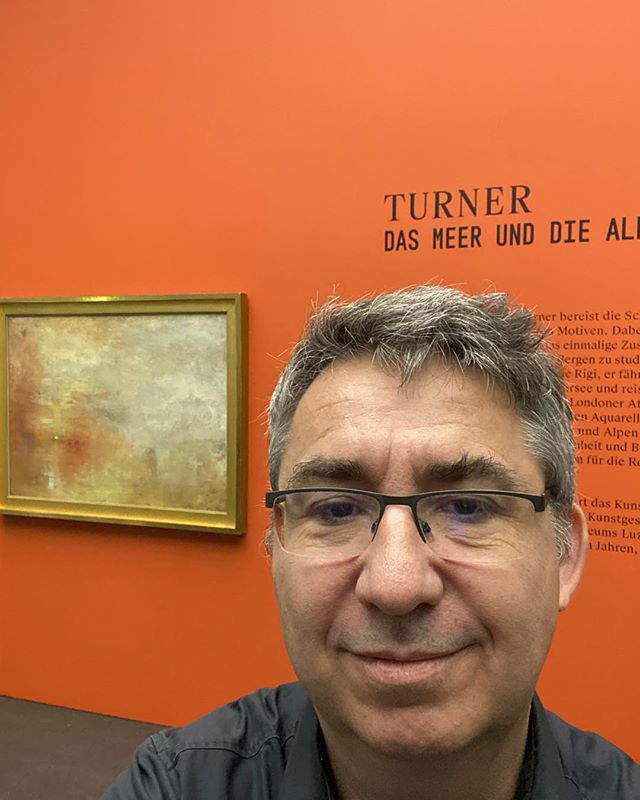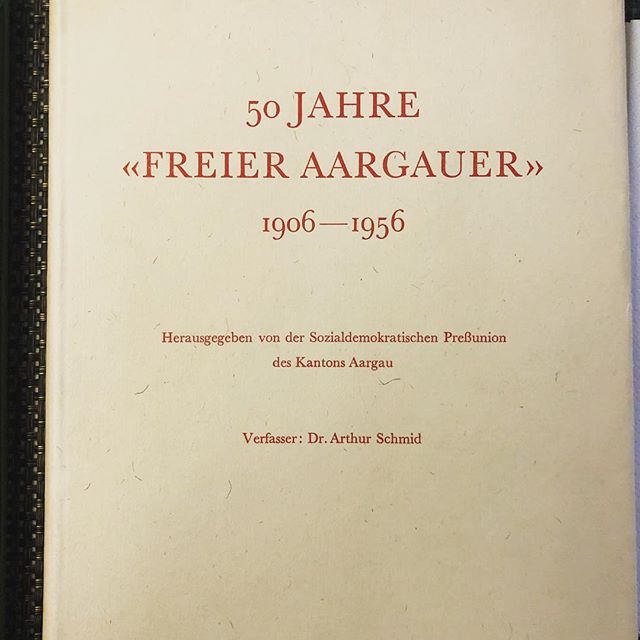In der DRS2 Sendung "Atlas" vom 13.5.2007 zum Thema Luxemburg findet sich eine aufschlussreiche Sequenz mit und zum Luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker.
Am besten hören Sie sich die Sequenz (1 min.) hier kurz an:
Diese kurze Minute ist beladen mit Behauptungen, transportiert sowohl durch die Journalistin wie auch durch Premierminister Juncker, wie ich sie immer wieder auch in Gesprächen im Freundeskreis höre.
Behauptung Nr.1: Linken liegt das Wohlergehen der Menschen am Herzen, Liberalen nicht.
Die Aussage im Beitrag im Wortlaut: "...dort allerdings dürfte er den linken Rand darstellen. Das Wohlergehen der Menschen liegt ihm ernsthaft am Herzen, hier spricht kein kalter Wirtschaftsliberaler." (Sprecherin im Radiobeitrag)
Der Unterschied zwischen Liberalen und Sozialisten liegt nicht darin, dass den einen das Wohlergehen der Menschen am Herzen liegt und den anderen nicht. Der Unterschied liegt vielmehr in den Ansichten darüber, mit welchen Mitteln das Wohlergehen der Menschheit realisiert werden kann.
Es handelt sich hier um eine immer wieder angewandte rhetorische Methode, nicht zum eigentlichen Thema (in diesem Falle: Wie kann das Wohlergehen der Menschheit realisiert weren) zu argumentieren, sondern den Gegener zu diskreditieren (in diesem Falle: Wirtschaftsliberale sind kalte egoisten).
Liberale Überlegungen zur Organisation unserer Gesellschaft haben genauso wie sozialistische, das Ziel, für möglichst vielen Menschen möglichst viel Glück zu erreichen. Liberale gehen dabei von der Prämisse aus, dass "Glück" eine individuelle Einschätzung ist, während bei den Sozialisten einen Vorstellung von einer "Gleichheit des Glücks" zugrunde liegt. Weiterhin liegt in der liberalen Grundhaltung die Überlegung, dass ein möglichst hoher Grad an individueller Freiheit zu besseren Ergebnissen führt, während die Sozialisten eher dazu tendieren die Freiheiten des Einzelnen zu gunsten des Kollektivs einzuschränken. Und als drittes Unterscheidungsmerkmal kann man erkennen, dass Liberale die Verteilung von Gut und Böse in jeder beliebig denkbaren Gesellschaftsgruppe als gleich betrachten, während die Sozialisten der Meinung sind, das Böse ist bei den Vermögenden zum Beispiel stärker vertreten als bei den weniger Vermögenden.
Es gibt für beide Denkhaltungen eine ganze Menge guter Argumente dafür oder dagegen. Diese und nur diese sollen diskutiert und beurteilt werden und nicht Aussagen über die Vertreter einer Denkrichtung.
Behauptung Nr. 2: Eine liberale Wirtschaftsordnung führt zu vielen Stellen auf Zeit.
Premierminister Juncker zählt zuerst ein paar Begriffe nebeneinander auf: "...Privatisierung, Präkarisierung, Partialisierung der Arbeitsverhältnisse..." und suggeriert damit einen Zusammenhang dieser Begriffe. Danach erklärt er diese zu "...Teufelszeug..." und garniert zum Schluss seine Aussage mit der Geschichte über seinen Vater, den Stahlarbeiter, der ihm, wenn dieser "nur immer ein befristetes Arbeitsverhältnis" gehabt hätte, kein Studium hätte finanzieren können.
Die letzte Aussage, dass sein Vater sein Studium nicht hätte finanzieren können, wenn er "..sich alle sechs monate hätte Fragen müssen, bleibe ich in Beschäftigung oder werde ich freigesetzt...", ist einfach mal so aufgestellt. Keine Fakten, die diese Behauptung unterstützen würden und aus meiner Sicht, gibt es auch keinen Grund diese als wahr zu beurteilen. Aber eigentlich ist das auch gar nicht wichtig, denn hier sehen wir eine weitere rhetorische Methode an der Arbeit: Etwas zu behaupten, was gar nicht zur Debatte steht.
Zur Diskussion steht eigentlich die Behauptung: Die veränderten und vergrösserten Kapitalströme sind dafür verantwortlich, dass in einigen, eher grossen EU Ländern, immer mehr Stellen nur auf Zeit angboten werden.
Versuchen wir diesem oft gehörten Argument einmal auf den Grund zu gehen.
Eine wichtige, oft nicht explizit ausgesprochene Aussage in diesem Zusammenhang ist, dass es frühr besser war. Auch hier in unserem Beispiel spricht Premierminister Juncker ja davon, dass sein Vater sich noch auf eine sichere Stelle habe verlassen können. Gehen wir einmal davon aus, dass diese Aussage wahr ist. Folgt nun daraus schon, dass der sogenannt "ungezähmte" Kapitalismus für die veränderte Situation von heute verantwortlich ist. Selbst wenn wir versucht sein würden, unsere Gesellschaft derart vereinfacht zu interpretieren (aus A folgt B), können wir auf keinen Fall diesen Schluss ziehen.
Die Art und Weise wie das Kapital eingesezt wird hat sich zwar in den letzen 50 Jahren massiv verändert, daneben aber auch viele andere ebenso relevante Erscheinungen. So ist die Regulierungsdichte in einem noch nie dagewesenen Masse angestiegen, das fortwährende Wirtschaftswachstum hat die Volksvermögen in der westlichen Welt explodieren lassen, die Transport- und Informationstechnologien haben zusammen mit den weltpolitischen Veränderungen die Wirtschaftskreisläufe immer globaler werden lasssen, die Automatisierung von Industrieprozessen hat viele Berufe verschwinden lassen, usw.
Es gibt nun keinen plausiblen Grund, einer einzigen dieser Erscheinungen (veränderte und grössere Kapitalströme) die Verantwortung für eine Folge (hohe Arbeitslosigkeit und viele Stellen auf Zeit in gewissen Ländern) allein zuzusprechen, ohne die anderen nicht auch in Erwägung zu ziehen.
Ich könnte zum Beispiel genauso behaupten: die Automatisierung vieler Industrieprozesse hat dazu geführt, dass vermehrt Stellen auf Zeit angeboten werden. Auf den ersten Blick eher nicht so plausibel, müsste man noch genauer analysieren.
Oder: Die fortwährende Regulierung gewisser Arbeitsmärkte, insbesondere der laufend ausgebaute Kündigungsschutz hat dazu geführt, dass Unternehmer vermehrt stellen auf Zeit anbieten. Das macht wohl schon eher Sinn, oder?
Natürlich wäre es auch hier völlig falsch, nur das eine Phänomen für die Folge der Stellen auf Zeit verantwortlich zu machen, aber mindestens könnte diese Variante genauso wahr sein, wie die von Premierminister Juncker behauptete.
Solche Erscheinungen innerhalb eines so komplexen Untersuchungsgegenstandes, wie unserer Gesellschaft, kann man nicht einfach einer einzigen Ursache zuschreiben. Es ist leider nicht so simpel. Kommt dazu, dass es überall, auch innerhalb von Europa völlig unterschiedliche Ausprägungungen dieser Phänomene gibt, abhängig davon welche Ebene wir betrachten. So ist die Situation in Deutschland eine andere als zum Beispiel in Schweden, oder die Situation in der Bergbaubranche eine andere als in der Automobilbranche, usw.
Diese beiden Beispiele anhand einer Minute Radioberichterstattung aus einer eigentlich unpolitischen, und übrigens grundsätzlich empfehlenswerten, interessanten Sendung von Schweizer Radio DRS2, sind zufällig aber exemplarisch für die Art und Weise wie wir tagtäglich mit wichtigen gesellschaftliche Fragestellungen umgehen.
Eine Verluderung der Argumentationskultur hat sich breit gemacht, bis in die höchsten Ämter. Es werden Dinge behauptet ohne diese zu begründen und es wird vor allem nicht über die eigentlichen Herausforderungen und Lösungsalternativen debattiert, sondern die ganze Energie darauf verschwendet, dem inhaltlichen Gegner, schlechte Absichten zu unterstellen. Das ist schade, dumm und wird uns nicht weiterbringen.
sapere aude