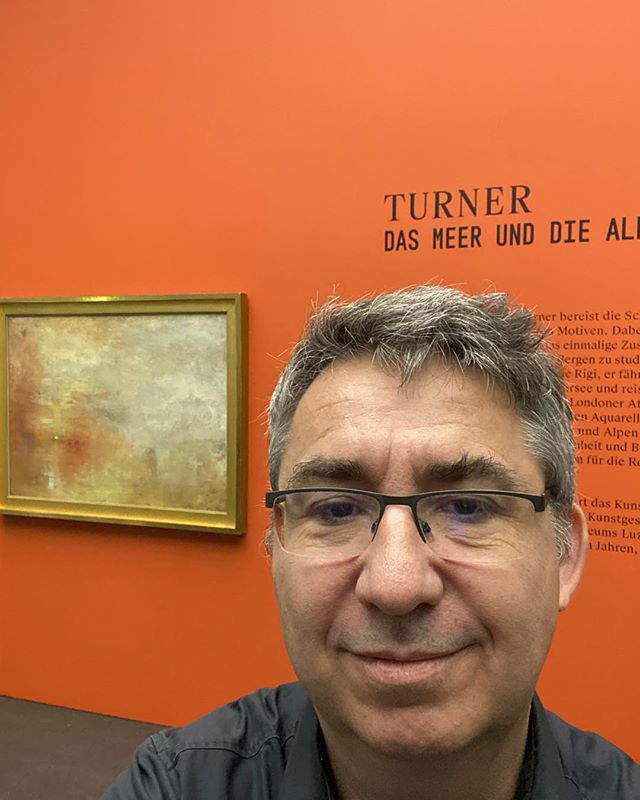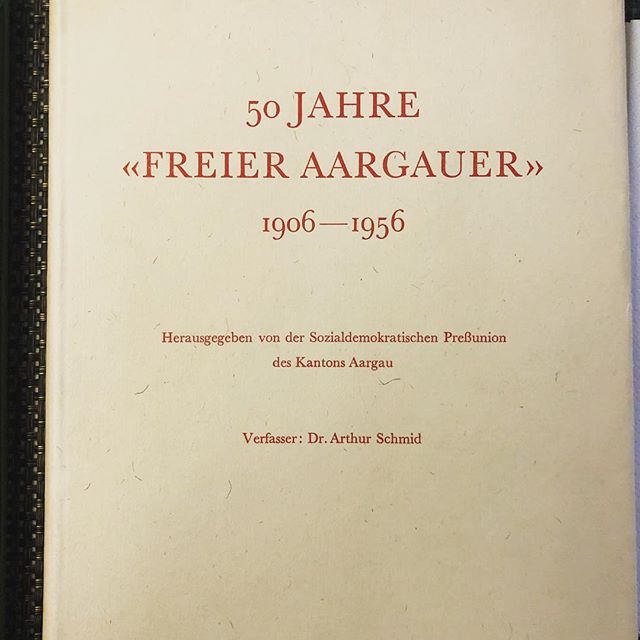Mit der CVP auf dem Weg zum Polizei- und Überwachungsstaat
/ Die CVP hat Alarm geschlagen. Die Sicherheit in der Schweiz sei, wenn es so weiter geht, bald nicht mehr gewährleistet. Damit es nicht soweit kommt, hat die Partei ein Massnahmenpaket zusammengestellt, welches uns aufhorchen lassen muss. Wenn eine Mitte-Partei derart auf Law-and-Order setzen, verheisst das nichts gutes für unsere Zukunft und vor allem nicht für die kommenden Debatten zur BÜPF-Revision und zum Nachrichtendienstgesetz.
Die CVP hat Alarm geschlagen. Die Sicherheit in der Schweiz sei, wenn es so weiter geht, bald nicht mehr gewährleistet. Damit es nicht soweit kommt, hat die Partei ein Massnahmenpaket zusammengestellt, welches uns aufhorchen lassen muss. Wenn eine Mitte-Partei derart auf Law-and-Order setzen, verheisst das nichts gutes für unsere Zukunft und vor allem nicht für die kommenden Debatten zur BÜPF-Revision und zum Nachrichtendienstgesetz.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich Reto Nause immer noch nicht von der "Tanz-Dich-Frei-Geschichte" erholt hat. Hier ein paar Kostproben davon, wie die Christlichen Demokraten gedenken, den Teufel aus der Gesellschaft zu vertreiben (aus der Medienmappe mit dem Positionspapier PDF):
- ...Die CVP unterstützt deshalb die Einführung von Schnellverfahren, vor allem bei Grossanlässen mit absehbarem Gewaltpotenzial
- ...Wer sich an einer bewilligungspflichtigen Versammlungen oder Kundgebungen vermummt, erschwert oder verunmöglicht bewusst eine spätere Identifizierung. Die CVP fordert die Schaffung strafrechtlicher Instrumente, die auch dann greifen, wenn eine Gruppe Vermummte in ihrer Mitte vor dem Zugriff durch die Polizei schützt
- ...Das Strafmass für Landfriedensbruch muss heraufgesetzt werden, tatverdächtige Angehaltene sollen bis zu 72 Stunden in Gewahrsam genommen werden können.
- ...Insbesondere bei der Aufklärung von Straftaten bei unbewilligten Anlässen oder Gewaltausbrüchen sind nicht unverhältnismässig hohe Ansprüche an die Internetfahndung zu stellen
- ...Heute haben weder die Polizei noch der Nachrichtendienst des Bundes die Möglichkeit in Fällen von Gewaltextremismus präventiv oder nach Gewalteskalationen reaktiv Telefone abzuhören oder Emails zu überwachen. Die CVP fordert die Schaffung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen
- ...Social Media-Kanäle, über die anonyme Aufrufe zu unbewilligten Veranstaltungen wie „Tanz dich frei“ veröffentlicht werden, müssen zur Zusammenarbeit mit den Behörden verpflichtet werden können.
- ...Die CVP unterstützt die Schaffung eines internationalen Regelwerks, welches internationale Verhaltensregeln, Standards und Normen über das Verhalten im Internet festlegt.
- ...Die CVP hält weiterhin an ihrer Forderung nach 3000 zusätzlichen Polizisten fest.
- ... Bestehende Videoüberwachungssysteme von Strassen sollen technisch aufgerüstet werden, so dass sie Kontrollschilder automatisch scannen und mit dem eidgenössischen Fahndungsregister Ripol, welches Datenbanken für Personenfahndungen, Fahrzeugfahndungen, Sachfahndungen und ungeklärte Straftaten umfasst, abgleichen können.
- ...Der Nachrichtendienst des Bundes muss über die nötigen Kompetenzen für Einsätze im In-
und Ausland verfügen, um als Frühwarnsystem zugunsten des Bundes und der Kantone proaktiv zu wirken. - ...Mit mehr Begleitpersonal, Überwachungskameras etc. verbessern wir die Sicherheit auf den Bahnhöfen und in den Zügen und garantieren die Sicherheit der Passagiere.
- ...Der öffentliche Raum muss durch präventive Stadtgestaltung, bessere Beleuchtung und den verstärkten Einsatz von Videokameras an Brennpunkten Verwahrlosung, Vandalismus, Diebstählen, Wohnungseinbrüchen sowie Gewalt vorbeugen.
Zusammengefasst: Überwachung, Überwachung, Überwachung total, kombiniert mit Erhöhung des Gewaltpotentials des Staates. Und das alles nur, weil ein beleidigter Gemeinderat von Facebook keine Antwort auf seinen Brief erhalten hat.